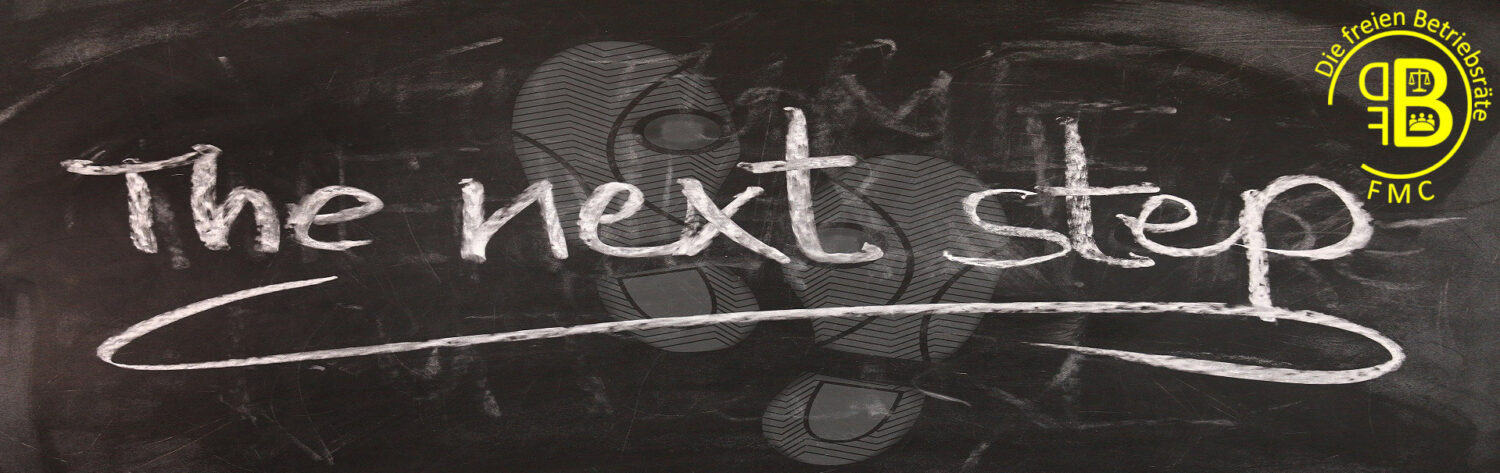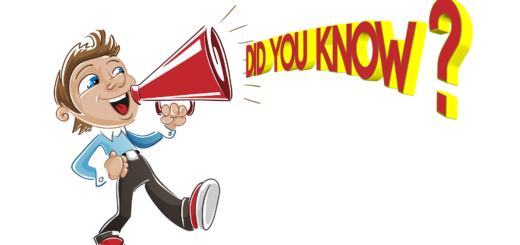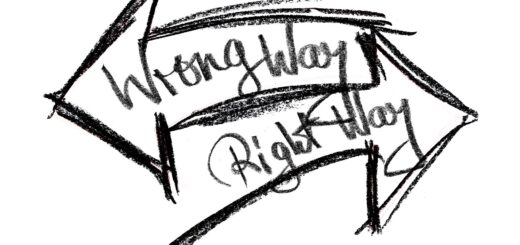Gleichberechtigung
Ausübung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
Die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes beschränkt sich grundsätzlich auf den Betrieb und seine Arbeitnehmer. Innerhalb „seines“ Betriebes ist es dem Arbeitgeber verwehrt, einzelne Arbeitnehmer oder Gruppen ohne sachlichen Grund von (begünstigenden) Regelungen auszunehmen. Auch eine Schlechterstellung kommt nicht in Betracht. Die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auf Unternehmens- oder Konzernebene ist in aller Regel wegen der unterschiedlichen Aufgabenstellungen als problematisch anzusehen.
Bei der Begründung von Arbeitsverhältnissen sind geschlechtsbezogene Benachteiligungen verboten.
Nach § 612 Abs. 3 BGB darf ein Arbeitgeber Frauen und Männer, die gleiche oder gleichwertige Arbeit leisten, nicht unterschiedlich entlohnen. Ist die Vergütung in Tarifverträgen, betrieblichen Entgeltvereinbarungen oder aufgrund betrieblicher Übung (Handhabung) geregelt, ist eine unterschiedliche Behandlung am Gleichbehandlungsgrundsatz zu messen.
Teilzeitbeschäftigte dürfen nicht schlechter bezahlt werden als Vollzeitbeschäftigte.
Es spielt dabei keine Rolle, ob der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer bereits einen Hauptberuf ausübt, Rente bezieht oder als Student sozialversicherungsfrei ist.
Bei allgemeinen Lohnerhöhungen muss der Arbeitgeber den Gleichbehandlungsgrundsatz beachten. Er darf z.B. keine Arbeitnehmer ausschließen, die vor der Erhöhung arbeitsunfähig erkrankt waren.
Bei freiwilligen Lohnerhöhungen findet der Gleichbehandlungsgrundsatz dann Anwendung, wenn der Arbeitgeber nach allgemeinen, abstrakten Regeln verfährt.
Grundsätzlich können übertarifliche Zulagen z.B. im Falle einer Tariflohnerhöhung angerechnet werden. Ausgeschlossen ist dies dann, wenn die Zulage als selbstständiger Lohnbestandteil im Arbeitsvertrag vereinbart ist. Bei einer Anrechnung ist der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Ohne sachlichen Grund kann ein Arbeitgeber die Anrechnung nicht bei einigen Arbeitnehmern vornehmen, während er die Anrechnung bei anderen unterlässt.
Bei der Gewährung von freiwilligen Leistungen, wie z.B. Gratifikationen, findet der Gleichbehandlungsgrundsatz ebenso Anwendung. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber die Leistung nach allgemeinen Regeln erbringt. Arbeiter und Angestellte dürfen bei der Gewährung von Gratifikationen aus besonderen Anlässen wie z.B. Weihnachten, nicht unterschiedlich behandelt werden.
Schließt ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer in gekündigter Stellung von der Zahlung einer freiwilligen Gratifikation aus, so stellt dies keine Ungleichbehandlung dar.
Bei der Gewährung von freiwilligem zusätzlichen Urlaubsgeld ist der Gleichbehandlungsgrundsatz ebenso anzuwenden wie in den vorher beschriebenen Sachverhalten. Dies gilt auch für Teilzeitbeschäftigte.
Wird die Zahlung von vermögenswirksamen Leistungen gewährt, ist der Arbeitgeber ebenfalls an den Gleichbehandlungsgrundsatz gebunden.
Gleichbehandlung überwachen
Zusammen mit dem Arbeitgeber hat der Betriebsrat darüber zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden.
Das heißt, dass vor allen Dingen jede Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung nach § 75 BetrVG unterbleiben muss.
Sowohl der Betriebsrat als auch der Arbeitgeber sind also gesetzlich dazu verpflichtet, fremdenfeindlichen Diskriminierungen aktiv entgegenzutreten.
Beteiligungsrechte des Betriebsrats
Zentrale Vorschrift für den Betriebsrat zur Überwachung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist § 75 BetrVG. Der Betriebsrat hat, falls er über Beweise bzgl. einer Nichteinhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes verfügt, beim Arbeitgeber die Abschaffung des Zustandes zu erwirken. Er hat gem. § 80 Abs. 1 Nr. 2a die Durchsetzung der entsprechenden Vorschriften voranzutreiben.
Die Rechte bei Diskriminierungen
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet jede unzulässige Benachteiligung von Beschäftigten wegen eines Diskriminierungsmerkmals aus § 7 Abs. 1 AGG.
Diskriminierungsmerkmal sind in § 1 AGG geregelt. Danach sind rassistische und fremdenfeindliche Benachteiligungen aus folgenden Gründen unzulässig:
- Aus Gründen der Rasse: Das ist eine Menschengruppe, die aufgrund bestimmter, als unabänderlich und angeboren empfundener Merkmale von Außenstehenden anders wahrgenommen wird. Beispiel: Menschen mit dunkler Hautfarbe.
- Wegen der ethnischen Herkunft: Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, die durch gemeinsame Eigenschaften, wie zum Beispiel Sprache, Kultur, Tradition, Religion oder Gebräuche verbunden sind.
- Wegen der Religion oder Weltanschauung.
Daneben verbietet das AGG Diskriminierungen wegen des Geschlechts, wegen einer Behinderung, wegen des Alters und wegen der sexuellen Identität.
Benachteiligen heißt, einen Menschen wegen der hier aufgeführten Merkmale anders zu behandeln, als man es bei einem Menschen tun würde, der das entsprechende Merkmal nicht aufweist.
Nur ausnahmsweise kann eine solche unterschiedliche Behandlung nach § 8 AGG gerechtfertigt und damit zulässig sein. Dies ist der Fall, wenn
- das Merkmal wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder
- wegen der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt,
- der mit der Anforderung verfolgte Zweck rechtmäßig ist und
- die Anforderungen angemessen sind.
Beschwerderecht
Fühlt sich eine Kollegin oder eine Kollege wegen eines fremdenfeindlichen Verhaltens diskriminiert, sollte sie oder er sich beschweren. Das Recht dazu ergibt sich aus § 13 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Der Betriebsrat sollte den oder die Betroffene natürlich dabei unterstützen.
Schadensersatz
Eine Diskriminierung durch Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit kann nach § 15 AGG auch Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche auslösen. Im Rahmen der Schadensersatzpflicht muss der Arbeitgeber den betroffenen Mitarbeiter so stellen, wie er gestanden hätte, wenn er nicht diskriminiert worden wäre.
Fristen beachten
Forderungen nach Zahlung einer Entschädigung und Schadensersatz müssen dem Arbeitgeber gegenüber innerhalb von 2 Monaten schriftlich geltend gemacht werden (nach § 15 Abs. 4 AGG). Mit der Geltendmachung der Forderungen ist es unter Umständen noch nicht getan. Denn kommt Ihr Arbeitgeber der Forderung nicht nach, muss Ihr Kollege innerhalb von 3 Monaten nach der Geltendmachung nach § 61b Abs. 1 Arbeitsgerichtsgesetz klagen. Die Klagefrist gilt auch für Entschädigungsansprüche nach § 15 AGG.
Unser Fazit:
Wir werden mit allen uns zur Verfügung stehen Mitteln dagegen ankämpfen, sollte es zu solchen Fällen bei uns kommen. Wir bietem jeden Betroffenen unsere volle Unterstützung an. Wir dulden keine Zweiklassengesellschaft. Wir unterscheiden auch nicht zwischen Produktion und Entwicklung, wenn dies nicht zwingend erforderlich ist. Wir bestehen auf die deutsche Sprache während der Arbeitszeit, außer in Bereichen in denen andere Sprachen zur Bewältigung der Arbeit nötig sind, denn wir möchten das Einwanderer bei uns voll integriert werden und wollen damit auch Unstimmigkeiten oder falschen Beschuldigungen vorbeugen.